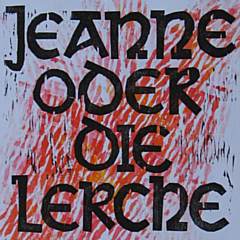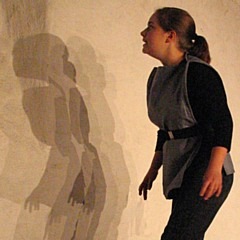|
|
Die Lerche hoch im Himmel
Die Theater AG der Maria Ward Schule spielt "Jeanne oder die Lerche"
von Jean Anouilh.
Wer das Theater der Maria Ward Schule besucht, muss in den Keller
hinuntersteigen, in einen Keller, der zwar sehr schön ist, aber nicht
sehr hoch. Dort unten spielen die Mädchen der Theater AG das Spiel
von Jeanne, der Lerche, die hoch in den Himmel aufsteigt. Und es gelingt.
Das Stück beginnt als deutliches Bühnenspiel. Alle Spielerinnen treten
auf, suchen ihre Kostüme, richten die Bühne her, nehmen ihre Plätze
ein. Das Stück zeigt dann den Prozess der Jungfrau von Orleans zu Rouen.
Jeanne steht ihren geistlichen Richtern gegenüber: einem mitfühlenden
Bischof, einem bigotten Eiferer als Ankläger, einem sich ihr zuwendenden
jungen Pater und dem Inquisitor, der den Menschen zu Gottes blutiger Ehre
hasst. Dazu kommt noch Graf Warwick, der elegante Engländer, der
eigentliche Herr des Verfahrens. Sie stellen Jeanne die theologischen,
politischen und menschlichen Fragen nach ihren Stimmen, nach ihrem Leben
auf dem Bauernhof ihrer Eltern, nach ihrer Begegnung mit Beaudricourt,
nach ihrem Auftritt am Königshof, nach ihrer Unterredung mit dem Dauphin,
nach ihrer Freude am Soldatenleben, nach ihrem Fall und nach dem bitteren
Ende. Und immer wenn die Jungfrau Antwort gibt, blendet Anouilh die
genannten Szenen ein, übergangslos, Raum und Zeit werden aufgehoben, die
Figuren, die gebraucht werden, treten einfach auf und spielen mit Jeanne
ihren Anteil an der Geschichte. Dazwischen gibt es noch Szenen am
französischen Hof, die die Machenschaften der Politiker und des Klerus
zeigen, und die Charles, den Dauphin mit seinen Frauen vorstellen,
Schwiegermutter, Ehefrau und Mätresse, das arme Hähnchen in seinem
Weiberhof.
Anouilhs Text ist immer dann schön, wenn er lyrisch wird, wenn er
skeptisch und witzig ist. Wenn religiöse Grundsatzfragen behandelt
werden, wenn es gar religionskritisch wird, wirkt das Stück trocken,
bemüht und verliert seine Leichtigkeit. Das Stück ist 1953 geschrieben
worden. Seitdem sind wir ganz andere, schärfere Töne gewöhnt, wenn es um
Kritik an der Kirche geht. Doris Kaiser hat mit ihrer Truppe deswegen die
meisten dieser Stellen gestrichen, ungefähr die Hälfte des Textes, was
dem Stück sehr bekommt.
Die Regisseurin hat ihre Darstellerinnen so geführt, dass sie auch ohne
Text ausdrucksstark und präsent sind. Johanna Edler als Inquisitor
strahlt eine abweisende Kälte aus, sie ist gefährlich, verbreitet eine
Atmosphäre der Beklemmung lange bevor sie etwas sagt. Stephanie Schüler
findet den verhaltenen, umsichtigen Ton für die väterliche Besorgtheit
des Bischofs Cauchon, Patricia Sieck zeigt die Menschlichkeit des Bruders
Ladvenu, Anja Rode führt die Dümmlichkeit des geistlichen Anklägers vor,
der ständig Dinge fordert, die er offensichtlich nicht versteht. Diesen
vier Vertretern der Geistlichkeit ist in den Spielszenen noch der
Erzbischof zugeordnet, Judith Maurer, als Beispiel für einen Kleriker,
der sein Amt ausschließlich politisch sieht. Julia Regis darf neben
soviel Geistlichkeit als LaTremouille und als Beaudricourt eine andere
Sorte Männer vorführen: stumpf, laut, geil und beschränkt. Zum großen
Vergnügen des Publikums spielt sie mit viel Witz den begriffsstutzigen
Kommisskopf. Constanze Wriedt zeigt als Vater und Henker zwei Männer, die
ihre jeweilige Männerrolle ganz angenommen haben. Antonia Regis als
Jeannes Bruder und Teresa Pika als Page sind sozusagen der Männernachwuchs
der Gruppe.
Dorothea Möring ist Charles, der Dauphin. Er hat sich damit abgefunden,
dass alle ihn herumstoßen und für ihre Interessen benutzen und er hat
auch jede Gegenwehr schon aufgegeben. Er ist nicht nur zu schwach, um
sich gegen die Politiker zu wehren, vor allem seinen Frauen kann er gar
nichts entgegensetzen. Nicht nur seine Geliebte Agnes Sorel, Daria
Kelnhofer stellt mit sichtlichem Genuss ihre Zickigkeit aus, und Rebecca
Sall, seine offizielle Königin, nerven ihn mit Mode und Geldforderungen,
und wenn sie um ihn konkurrieren, geht es ums Gewinnen, nicht um ihn.
Auch seine Schwiegermutter hat Ansprüche, sie möchte einen König aus ihm
machen. Rebecca Lang zeigt sie als weise, abgeklärte Dame, die meint, man
müsse sich mit den Verhältnissen am Hofe arrangieren. Rebecca Lang spielt
aber auch noch Jeannes Mutter, dabei zeigt sie eine ganz andere,
schlichtere Mütterlichkeit, aber auch die meint, man müsse sich mit den
Verhältnissen auf dem Dorf arrangieren.
Jeanne erst zeigt dem armen Charles, wie er sich befreien kann, sie hilft
ihm seine Feigheit in Mut zu verwandeln, sich seiner Angst zu stellen,
endlich zum König zu werden und ihr den Oberbefehl zu übergeben. Anouilh
zeigt aber auch, dass der Dauphin ohne Jeanne sich wieder feige mit den
Gegebenheiten arrangiert.
In diesem Stück gibt es aber noch einen Mann, Graf Warwick, gespielt von
Danja Höhn. Ihm hat Doris Kaiser alle kabarettistischen Sprüche über
England und Frankreich gestrichen, und die 1953 modischen Reden an das
Publikum. Dadurch hat sie ihm eine große Würde gegeben: in dieser
Aufführung wird er zum eigentlichen Gegenspieler Jeannes, denn er nimmt
bewusst die Rolle auf sich, die seine Familie und sein Stand ihm
auferlegen, er wartet darauf, dass die Dinge sich einrenken. Wie Kreon in
"Antigone" wird er seine Aufgabe erfüllen, weil sie getan
werden muss. Jeanne will das nicht, sie widerruft ihr Geständnis und
wählt, wie Antigone, den Tod, weil das Leben, die Dinge, die sich
einrenken, sie von ihrem Selbst trennen würden.
(Jean Anouilh "Antigone" von der Theatergruppe der Maria Ward
Schule 1999 gespielt)
Marie-Theres Pietschmann spielt diese Jeanne. Sie hat die Kraft der
wundersamen Jungfrau und die kindliche Heiterkeit der Erwählten, sie
strahlt eine gotteskindliche Fröhlichkeit aus und eine zupackende
Frömmigkeit. Sie trägt die ganze Aufführung mit der Lebendigkeit ihrer
Sprache. Sie hat eine reiche Palette von Klangfarben, von fahlen Tönen
der Verzweiflung, bis zum hellen Lerchenton, sie gibt die Melodie der
Aufführung vor.
Nicht vergessen werden dürfen die Schülerinnen und Mütter, die die
schönen Kostüme nähten, das Plakat entwarfen und druckten, die die
Aufführung mit Licht und eingespielter Musik bereicherten, das Programm
nennt ihre Namen. Die einzige der notwendigen Helfer, die in Erscheinung
trat, war die Souffleuse Dorothee Jochimsen.
Anouilh lässt sein Stück mit einem Theatercoup enden. Ausgerechnet
Beaudricourt vermisst die Krönung in der Geschichte und da der Autor
schon das ganze Stück mit Zeit und Raum gespielt hat, wird der schon
brennende Scheiterhaufen eingerissen und die feierliche Krönung wird als
textlose Liturgie nachgeschoben. Jeanne soll im größten Triumph ihres
kurzen Lebens gezeigt werden. Dieser Bilderbuchschluss ist wichtig für
Anouilh und seinen Zugriff auf den oft bearbeiteten Stoff. Für diese
Aufführung ist er es nicht. Dichter, vitaler, energiegeladener als bei
der Scheiterhaufenszene ist das Ensemble nie. Und heller als auf dem
Scheiterhaufen klingt der Jubelton der Lerche nie - der Lerche hoch im
Himmel.
Wolfgang Bachtler
|